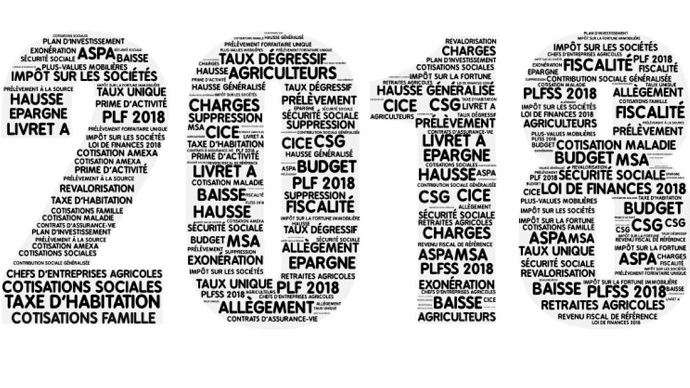
Per quanto riguarda i giubilei, il 2018 sembrerebbe stare sotto il segno del materialismo dialettico, quel movimento di pensiero della sinistra hegeliana che si rifà a Karl Marx e Friedrich Engels. Marx stesso si trova sotto un segno giubilare: nel 2018 ricorre infatti il suo duecentesimo genetliaco. Il secondo giubileo a cui mi riferisco non riguarda tanto una persona, quanto piuttosto la sua opera prima uscita appunto nel 1918: si tratta de Lo Spirito dell’utopia di Ernst Bloch, un classico del neo-marxismo (volendo potremmo anche aggiungere il suo Ateismo nel cristianesimo, pubblicato nel 1968).
Visto che l’anno fiscale volge oramai al suo termine e, come sempre, questo accade nella prossimità del Natale, vale forse la pena pensare un po’ più a fondo questa casuale associazione storica. Infatti, quale tempo migliore se non quello che precede il Natale per una piccola meditazione di spirito marxista? Quale stagione dell’anno se non proprio questa in cui l’uomo occidentale, con quell’immaturità da lui stesso voluta (liberamente, senza costrizione alcuna – almeno così ci fanno credere grazie al «paternalismo libertario» e al «nudge»), si accalca come un gregge di pecore nei centri commerciali e nei supermarket? Quando, se non proprio in quell’atmosfera meditativa in cui quest’uomo può finalmente lamentarsi in tutta buona coscienza di dover mangiare così tanto?
Il feticcio della merce
Nella prima parte de Lo spirito dell’utopia (che porta il titolo significativo di auto-incontro), Bloch offre un’interpretazione visionaria della moderna estetica della merce. La produzione commerciale è posta sotto il segno di una fredda macchina estetica «il cui vero scopo è la stanza da bagno e il gabinetto – le due prestazioni più originali e indubitabili del nostro tempo».[1] Qui «regna sovrana la lavabilità», annota Bloch.
Non è possibile nulla di particolare, di ornamentale, di vivente in un mondo che si basa solo su procedure efficaci, efficienza economica e funzionalità abitativa. Questa estetica, «anche là dove si vuole alleggerire, dove vetro, acciaio e cemento si agglomerano insieme così che la pura forma finale possa attuare la sua essenza disadorna», ci impone una «reminiscenza egizia».[2]
Ciò che qui Bloch intende è quello «spirito assoluto pietrificato», che l’antico Egitto dei faraoni (quegli uomini-dio che rappresentavano il loro potere nella forma della statua di pietra) portò fino alla sua perfezione parossistica per «rappresentare la signoria assoluta della natura anorganica sulla vita».[3] «La piramide, come afferma Hegel, non è altro che un reliquario nel quale vive un morto, il santissimo dello spazio profondo del tempio non è che una tomba (…)».[4]

La forza ornamentale, quasi straripante, delle parole di Bloch mostra l’ideologia che si cela dietro «questo mostruoso fanatismo della fissa rigidità»: la pretesa sublimità delle superfici piatte non è altro che un feticismo moderno. La superficie piatta è solo il gabinetto, la toilette, che elimina il più rapidamente possibile e senza residuo alcuno gli escrementi dell’ideologia (Marx parla di «escremento economico»).[5]
La speranza è che il sudiciume prodotto da ciò che rende possibile la «civilizzazione» occidentale scivoli semplicemente via lungo questa superficie. Già l’estetica del Biedermeier, richiamata qui da Bloch, non era altro che il feticcio della purezza che rendeva sopportabile per la borghesia l’olezzante realtà di produzione e sfruttamento nelle fabbriche (ossia la questione sociale tout court). Su questa linea si potrebbe continuare con Le Corbusier, il cui abbozzo di città ideale viene definito da M. Houellebecq come quello di un campo di concentramento.
La più recente iterazione di questa struttura è la Apple – o qualsiasi altra casa di produzione di smartphone, tablet e notebook. La piattezza della superficie è diventata in questo caso un eccesso ipertrofico. Il rifiuto della produzione (ossia quei bambini asiatici malati che negli slum non possono certo aspettarsi alcuna condizione di benessere che li preservi tra il troppo caldo e il troppo freddo) viene del tutto ignorato quando gli apparecchi elettronici diventano subito obsoleti.
Il telefono è così piatto che ha bisogno di un involucro di protezione – ma non tanto affinché non si danneggi, quanto piuttosto per riuscire almeno a tenerlo in mano. Ironicamente l’illuminazione definitiva si ribalta necessariamente nel suo contrario, perché essa rimanda in maniera sempre più veemente alla sporca realtà delle cose.

Ma la cosa si fa ancora più assurda: la purezza del telefono non scompare semplicemente dietro la custodia, ma quest’ultima diventa essa stessa un feticcio. Poiché in sé ognuno ha il medesimo noioso prodotto che non dice niente, allora ciascuno lo deve individualizzare per sé – con custodie di colori fluorescenti. Così qualcosa che dovrebbe rimandare solo alla parte sporca dell’ideologia viene esso stesso ideologicamente idealizzato e trasformato – nel senso dell’individualismo moderno. L’approdo di questo movimento appare essere dunque, tanto per parafrasare Marx che a sua volta parafrasa Hegel, «escremento in e per sé».[6]
Telefoni ronzanti e bronzi che rimbombano
In questo senso, lo smartphone rappresenta la merce per eccellenza; esso funziona infatti come incarnazione ultima dell’ideologia economico-liberale, portando a chiusura in se stesso il suo circolo vizioso pseudo-dialettico (per riaprirlo e richiuderlo all’infinito). Ad esempio, in Germania gira attualmente lo spot di un portale online per la comparazione dei prezzi (Idealo) nel quale un papà di famiglia accede a Internet attraverso un laptop (come si faceva una volta, appunto…) alla ricerca di un nuovo smartphone per sé. A questo punto, la figlia si rivolge a lui e, con aria da saputella, gli fa presente che ha già trovato un nuovo smartphone per lui grazie alla app di Idealo.
Il principio-smartphone funziona allo stesso modo del fumatore incallito che accende la nuova sigaretta direttamente da quello che rimane dell’ultima (che naturalmente viene buttata via non appena ha svolto questo suo compito).
Se la merce promette sempre un «di più», che di fatto non può offrire (e qui risiede il suo essere quel di feticcio di cui parla Marx), allora si può affermare che questa pubblicità riconosce in maniera sorprendentemente onesta e palese il carattere di feticcio della merce.[7] In questo luogo vuoto della merce (ossia il luogo che il prodotto non può riempire poiché è quello in cui esso può essere solo «quello» che è) non si produce alcuna prestazione aggiuntiva, ma si afferma solo la merce come ciò che succede a se stessa.
Questo è il riconoscimento ultimo e definitivo del fatto che dietro la merce non c’è davvero null’altro che la merce stessa. Nel caso dello smartphone, un blocco piatto e ronzante che viene prodotto solo per essere sostituito.

In maniera curiosa questo ci conduce nuovamente nell’antico Egitto. In una sua lezione, Hegel richiama il fenomeno affascinante di quelle statue egizie che, come per miracolo, nel momento in cui vengono sfiorate da un raggio di luce mattutina emettono un suono profondo.[8]
La produzione di questi monumenti di pietra è in diretto contatto con uno stadio precedente della coscienza dell’uomo che ora, al posto di adorare oggetti che si trovano nella natura, passa al tentativo di produrre egli stesso oggetti degni di essere adorati (quasi fosse costretto a fare tutto ciò). Perché forzato? Perché questi artefatti non potranno mai rispecchiare l’essenza spirituale. Lo spirito animante si raccoglie «morto in questi cristalli che non hanno bisogno alcuno della vita».[9]
Per Žižek è chiaro che la voce delle statue rimanda esattamente a questo vuoto essenziale: «La voce mette in mostra un’autonomia fantasmatica, che non è mai totalmente del corpo (…). È come se la voce di colui che parla lo volesse svuotare (…)».[10]
Altrettanto si potrebbe dire dello smartphone. Da questo blocco poco maneggevole risuona la voce dell’altro: oggi non tanto attraverso la chiamata diretta, ma sempre più spesso (distante non solo nello spazio ma anche nel tempo) attraverso il messaggio vocale lasciato su Whatsapp. Žižek ha del tutto ragione quando afferma che questo fenomeno simboleggia perfettamente «la nascita della soggettività».
Il vuoto che il soggetto umano condivide con la merce può essere rispecchiato di nuovo solo attraverso un’«immediata forma di apparizione dell’interiore» – e questo interiore può venire rappresentato unicamente da un qualcosa che non ha né forma né consistenza.[11]
In questo punto coincidono anche il sublime (ossia il soggetto, la persona nella sua singolarità dall’altra parte della linea) e l’escrementale senza forma (questo bronzo che rimbomba, come scrive Paolo in 1Cor 13,1); e, dunque, il punto di passaggio dall’uno all’altro scompare nell’identità dei termini. È interessante notare il fatto che qui Žižek rinvia qui a Freud, laddove egli descrive il fenomeno dei bambini piccoli che portano in regalo ai genitori i loro escrementi – ossia fanno di ciò che è il loro più interiore un presente.
Tra l’altro non c’è nulla che sembrerebbe rimandare meglio a questo vuoto del soggetto moderno che il fenomeno reale dei selfies direttamente associato allo smartphone. «Vedi mio caro io, e vedi mio caro non-io, io sono ancora qui! Io, questo amabile e unico individuo». Il selfie non è altro che il feticistico rimanere aggrappati all’individualismo moderno della pubblicità, la cui vuota promessa costringe l’individuo a mascherare il suo vuoto reale con questo comportamento narcisistico.
Per questo ci si fa dei selfies anche nelle situazioni più assurde: alle proprie nozze, al funerale della nonna, nei pressi di un incidente, durante i pasti e, dopo, naturalmente anche in bagno.[12]
Il sublime dell’imperfezione
Il vocabolo «presente» (regalo) ci riconduce al tema del Natale. Se nel frattempo la maggior parte delle feste cristiane sono state colonizzate dalla commercializzazione, si vede chiaramente come il Natale rappresenti l’apice di questo movimento. Quello che conta davvero è riuscire a evitare che la «festa dell’amore» venga ridotta a mera circolazione di merci varie. Come il breve rimando al passo di 1 Cor 13 già annuiva, Paolo può esserci di aiuto.
«Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita» (1Cor 13,1). Nella prospettiva della nostra riflessione si potrebbe parafrasare questo passaggio di Paolo nei seguenti termini: «Se regalo null’altro che merce, mediante la quale esprimo il mio amore, allora al mio regalo manca pur sempre il vero amore. Non rimane che il giocattolo di plastica a buon mercato o un noioso paio di calzini».

Paradossalmente, questa cianfrusaglia senza forma che ci regaliamo a vicenda rimanda esattamente a questo tentativo, pietoso e sublime al tempo stesso, di offrire all’altro la nostra interiorità come un presente. Ma la massa senza forma non può valere quale prestazione sostitutiva dell’amore: non rimane che il mero e commovente vuoto (si pensi solo all’espressione inglese «you can’t polish a turd (…)», a cui la banda inglese heavy-metal Cradle Of Filth aggiunge «(…) but you can roll it in glitter»).
Il vero amore, al contrario, è in grado di illuminare questo vuoto senza doverlo riempire con un «di più» numinoso. «E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe» (1Cor 13,3). Anche se dessi tutto l’amore mostra che, da ultimo, si tratta di nulla, che anche l’intero rimane incompiuto.[13]
 In questo senso, secondo Žižek, l’amore accorda all’incompiutezza, all’imperfezione, un valore più alto della perfezione. Nell’amore non ci si inganna sul vuoto del regalo, ma il vuoto viene compreso nella sua essenzialità. In questo modo la logica dell’amore interrompe il circolo vizioso del feticismo delle merci e dell’abissale amore narcisistico di sé tipico dell’individualismo moderno.
In questo senso, secondo Žižek, l’amore accorda all’incompiutezza, all’imperfezione, un valore più alto della perfezione. Nell’amore non ci si inganna sul vuoto del regalo, ma il vuoto viene compreso nella sua essenzialità. In questo modo la logica dell’amore interrompe il circolo vizioso del feticismo delle merci e dell’abissale amore narcisistico di sé tipico dell’individualismo moderno.
Ancor di più, infatti il regalo come monolite senza forma non rimanda a un qualche contenuto essenziale che sta dietro la carta da regalo, ma alla presenza del donatore stesso. E, come abbiamo visto parlando delle statue egiziane, anche la sua presenza è da ultimo vuota. Ma di nuovo l’amore dice che proprio questa incompiutezza è il sublime.
Il bello del Natale è che ci doniamo a vicenda così che ognuno possa diventare un donatore incompiuto e imperfetto. In tal modo la festa dell’amore rende possibile di raccogliere tutti gli amori nel qui e ora del presente, così che si possa veramente celebrare l’amore. Amiamo sempre l’imperfetto e l’incompiuto, perché è tale e anche noi lo siamo e possiamo esserlo.
Il vero amore non si dispiega in un lontano «dopo», in un paradiso o in qualcosa di simile, che promette un «di più» di felicità, di piacere o di Dio solo sa cosa. L’amore coglie questa semplice, fuggente presenza e fa di essa, qui e ora, la verità dell’incondizionato essere-insieme. E a Natale celebriamo esattamente questo amore.
E una cosa non bisogna dimenticare (e a questo per fortuna ci pensa il racconto di Natale): Cristo non è nato in una reggia, ma tra paglia e letame.

[1] Qui e in seguito: E. Bloch, Geist der Utopie. Faksimile der Ausgabe von 1918, Gesamtausgabe 16, Frankfurt/M. 1977, 21
[2] Ivi, 28.
[3] Cf. E. Bloch, Geist der Utopie. Bearbeitete Neuauflage der zweiten Fassung von 1923, Gesamtausgabe 3, Frankfurt/M. 1977, 32.33.
[4] Ivi, 33.
[5] Si pensi all‘esempio più amato da Žižek per illustrare l’ideologia di una nazione sulla base della costruzione delle sue toilette.
[6] Cf. K. Marx-F. Engels, Die deutsche Ideologie, Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Bd. 1, Berlin 1970, 223.
[7] Questo non vuol dire che questa pubblicità abbia in sé qualcosa di buono. Da ultimo qui non viene pubblicizzato alcuno smartphone ma un portale che si nutre del circolo vizioso capitalistico di produzione e consumo.
[8] Queste statue a cui si rifà Hegel potrebbero essere i Colossi di Memnone. Una qualche prima informazione la possiamo ovviamente trovare su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Colossi_di_Memnone. Qui e in seguito si veda S. Žižek, Die gnadenlose Liebe, übers. von N.G. Schneider, Frankfurt/M. 2001, 103-106.
[9] G.W.F. Hegel, Werke 3, Phänomenologie des Geistes, 14. Aufl., Frankfurt/M. 2017, 509.
[10] S. Žižek, Die gnadenlose Liebe, 105.
[11] Ivi, 105.
[12] L’inspiegabilità di questo comportamento ha ovviamente anche il suo corrispondente in Internet che ne tratteggia il carattere escrementale: dalla parte sinistra dell’immagine vediamo N. Armstrong in tuta spaziale con la luna sullo sfondo, da quella destra il selfie di una bella ragazza con un paio di gabinetti alle spalle. Accanto ad Armstrong troviamo il seguente testo: «Went to the moon, took 5 pictures»; accanto alla ragazza: «Went to the bathroom, took 37 pictures».
[13] Qui seguiamo S. Žižek, Die Puppe und der Zwerg. Das Christentum zwischen Perversion und Subversion, übers. von N.G. Schneider, Frankfurt/M. 2003, 116-118.
Weihnachtswunder: Warenfetischismus – Dialektisch-materialistische Weihnachtsgrüße

Hinsichtlich bedeutender Jubilare scheint das Jahr 2018 durchaus unter dem Zeichen des dialektischen Materialismus zu stehen, jener linkshegelianischen Denkbewegung die auf Karl Marx und Friedrich Engels zurückgeht.
1818 – 1918 – 2018
Beim Erstgenannten handelt es sich auch gleich um einen der besagten Jubilare, denn Marx wäre – bekanntermaßen – dieses Jahr zweihundert Jahre alt geworden. Das zweite Jubiläum bezieht sich hingegen weniger auf die Person selbst denn auf ihr Erstlingswerk, das im Jahre 1918 erschien. Die Rede ist von Ernst Blochs neomarxistischem Klassiker „Geist der Utopie“ (und wenn man wollte, könnte man hier auch noch sein „Atheismus im Christentum“ von 1968 einreihen).
Da sich das (Fiskal)Jahr nun langsam seinem Ende zuneigt, zudem – wie immer plötzlich – Weihnachten vor der Tür steht, wird es nun höchste Zeit einmal darüber nachzudenken, was es mit dieser historisch zufälligen Assoziation auf sich hat. Denn wann, wenn nicht in der Vorweihnachtszeit, scheint eine kleine, marxistisch angehauchte Meditation sonst angebracht? Wann, wenn nicht in jener Zeit des Jahres, in der sich der westliche Mensch in seiner neuen selbstverschuldeten Unmündigkeit (aber trotzdem ganz ‚freiwillig‘ – „Nudge“ und „libertärem Paternalismus“ sei Dank) herdenweise durch Kaufhäuser und Supermärkte treiben lässt? Wann, wenn nicht in jener besinnlichen Stunde, in der dieser Mensch sich endlich einmal guten Gewissens darüber beschweren kann, so viel essen zu müssen?
Ägypten – Biedermeier – Apple
Im ersten Abschnitt von „Geist der Utopie“, der bezeichnenderweise mit „Die Selbstbegegnung“ betitelt ist, bietet Ernst Bloch eine visionäre Deutung der modernen Warenästhetik an. Die Warenproduktion steht ganz unter dem Stern einer kalten Maschinenästhetik, deren „eigentliches Ziel … das Badezimmer und Klosett, die fraglosesten und originalsten Leistungen dieser Zeit,“ ist.[i] „Hier regiert die Abwaschbarkeit […]“, konstatiert Bloch. Nichts Besonderes, nichts Ornamentales, nichts Lebendiges ist noch erlaubt, in einer Welt, die auf reibungslose Abläufe, ökonomische Effizienz und funktionale Wohnmaschinerien setzt. Diese Ästhetik, „[a]uch dort, wo man nur entlasten will, wo Glas, Stahl und Beton zusammenwirken und derart die reine Zweckform […] ihr nüchternes Wesen treibt“, drängt uns seine „ägyptische Reminiszenz“ auf.[ii] Was Bloch damit meint, ist jener „absolute Steingeist“, den das alte Ägypten der Pharaonen (jener Gottmenschen, die gerade in Form der steinernen Statue ihre Macht repräsentierten) bis zur megalomanen Perfektion brachte, um die „totale Herrschaft der anorganischen Natur über das Leben“ darzustellen.[iii] „[D]ie Pyramide ist, wie Hegel sagt, ein Schrein, darin ein Toter haust, das Allerheiligste des tiefen Tempelraums ist nicht anders als ein Grab […]“.[iv]
Hingegen Blochs ornamentale, fast schon überquellende Wortgewalt bringt die Ideologie hinter diesem „ungeheuren Fanatismus der Starre“ hervor: Die vermeintliche Erhabenheit der glatten Oberflächen ist nichts weiter als ein moderner Fetischismus. Die glatte Oberfläche ist nur das Klosett, eine Toilette, die die offensichtlichen Exkremente der Ideologie (Marx spricht von der „ökonomischen Scheiße“) schnellstmöglich und ohne Rückstände wegbefördert.[v] Die Hoffnung ist, dass der Dreck, den die Ermöglichung der westlichen ‚Zivilisiertheit‘ produziert, einfach an diesen Oberflächen abperlt. So war bereits die Ästhetik des Biedermeier im 19. Jahrhundert, die Bloch hier einreiht, nichts anderes als der Fetisch der Reinheit, der die dreckige Realität der Produktion und Ausbeutung in den Fabriken, kurz die soziale Frage, für das Bürgertum erträglich machte. Man kann diese Reihe fortsetzen mit Le Corbusier, dessen Idealentwurf einer Stadt von Michel Houellebecq als Konzentrationslager bezeichnet wird.
Ihre jüngste Iteration bildet wohl Apple oder eigentlich jeder Produzent von Smartphones, Tablets und Notebooks. Die Glattheit der Oberfläche hat hier ein geradezu hypertrophes Ausmaß angenommen. So sehr muss der Abfall der Produktion (kranke ostasiatische Kinder, die in den Slums keine biedere Reinlichkeit zwischen zu warm und zu kalt erwarten dürfen) ignoriert werden, dass die elektronischen Geräte schon unpraktisch werden. Das Telefon ist so glatt, dass es eine Schutzhülle braucht, weniger zu dem Zweck, dass es nicht beschädigt wird, als vielmehr damit man es überhaupt noch in der Hand halten kann. Ironischerweise schlägt also die endgültige Verklärung notwendig in ihr Gegenteil um, da gerade sie um so vehementer auf die schmutzige Realität hinweist.
(Aber die Sache wird nach abstruser: Die Reinheit des Telefons verschwindet nicht einfach hinter der öden Hülle, nein, stattdessen wird die Hülle ihrerseits zum Fetisch. Da an sich jeder das gleiche langweilige, nichtssagende Produkt hat, muss es jeder für sich individualisieren, und zwar mit quietschbunten Handyhüllen. So wird das, was eben noch auf die schmutzige Seite der Ideologie hinwies, direkt selbst wieder ideologisch verklärt, nämlich im Sinne des modernen Individualismus. Das Ergebnis dieser Bewegung zeigt sich somit als – um den Hegel paraphrasierenden Marx zu paraphrasieren – „Scheiße an und für sich“[vi].)
Singende Steine – brummende Telefone – dröhnendes Erz
In diesem Sinne stellt das Smartphone die Ware par excellence dar, denn es fungiert als endgültige Inkarnation der liberal-ökonomischen Ideologie, deren pseudo-dialektischen Teufelskreis es in sich schließt (und wiedereröffnet usw. usf.). So läuft etwa gegenwärtig in Deutschland ein Werbespot des Online-Preisvergleichsportals Idealo, in dem ein Vater im Internet, auf das er – ganz ‚old school‘ – per Laptop zugreift, nach einem neuen Smartphone für sich sucht. Woraufhin sich seine Tochter an ihn wendet und altklug den Vater belehrt, dass sie in diesem Moment ein neues Smartphone über die hier beworbene Idealo-App für ihn gefunden hat. Das Smartphone-Prinzip funktioniert sozusagen wie das Kettenrauchen, bei dem man die nächste Zigarette direkt an der letzten (die man dann natürlich entsorgt) anzündet.
Wenn die Ware also immer ein „Mehr“ verspricht, welches sie aber eigentlich überhaupt nicht bietet (dies ist ihr Fetischcharakter, von dem Marx spricht), dann kann man paradoxerweise sagen, dass diese Werbung überaus ehrlich ist und offen den Fetischcharakter der Ware eingesteht.[vii] Denn in diese Leerstelle der Ware (also die Stelle, die das Produkt, dadurch, dass es nur ‚das‘ ist, was es eben ist, nicht ausfüllen kann) setzt sie nicht eine numinose Extraleistung, sondern sich selbst als ihr eigener unmittelbarer Nachfolger. Dies ist das ultimative Eingeständnis, das hinter der Ware wirklich nicht mehr steckt, als sie selbst. In diesem Fall, ein glatter, brummender Klotz, der dazu produziert wird, ersetzt zu werden.
Kurioserweise führt uns dies noch einmal ins alte Ägypten. So erwähnt Hegel in einer Vorlesung ein faszinierendes Phänomen, nämlich ägyptische Statuen, die wie durch ein Wunder in dem Moment, wo sie vom Morgenlicht beschienen werden, einen tiefen Ton von sich geben.[viii] Außerdem, so Hegel, steht die Fertigung dieser steinernen Monumente in direkter Verbindung mit dem frühen religiösen Bewusstsein der Menschen, die nun, anstatt Objekte, die sie in der Natur vorfinden, einfach nur anzubeten, nun selbst versuchen, diese anbetungswürdigen Dinge herzustellen – und dieses nicht zuletzt auch beinahe zwanghaft tun. Warum zwanghaft? Weil diese Artefakte eben niemals diese spirituelle Essenz widerspiegeln. Der beseelende Geist kehrt nur „tot in diese des Lebens entbehrenden Kristalle“[ix] ein, schreibt Hegel. Für Slavoj Žižek ist klar, dass die Stimme der Statuen genau auf diese essentielle Leere verweist: „Die Stimme stellt eine gespenstische Autonomie zur Schau, sie gehört nie völlig dem Körper […]: Es ist als ob die Stimme des Sprechers diesen aushöhlen würde […].“[x]
Zweifellos könnte das Gesagte auch ebenso gut auf das Smartphone übertragen werden. Aus diesem unhandlichen Klotz ertönt die Stimme des anderen, heutzutage weniger durch den direkten Anruf, dafür um so öfter durch die nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich distanzierte Sprachnachricht über Whatsapp. Žižek kann also vollkommen zurecht behaupten, dass dieses Phänomen die „Geburt der Subjektivität“ perfekt symbolisiert. Die Leere, die sich das menschliche Subjekt mit der Ware teilt, kann nur wieder durch eine „unmittelbare Erscheinungsform des Inneren“ widergespiegelt werden, und dieses Innere kann nur durch ein unförmiges, ungreifbares Etwas dargestellt werden.[xi] So stimmen auch an dieser Stelle also das Erhabene (das Subjekt, der einzigartige Mensch am anderen Ende der Leitung) und das Exkrementale (dieses „dröhnendes Erz“ (1 Kor 13,1), die „formlose Scheiße“ wie Žižek schreibt) überein bzw. der Übergangspunkt zwischen ihnen verschwimmt in der Identität der Terme. Interessanterweise verweist Žižek hier auf Sigmund Freud, der das Phänomen beschreibt, bei dem Kleinkinder ihren Eltern ihre Exkremente zum Geschenk machen, also unmittelbar ihr Innerstes zum Präsent machen.
(Im Übrigen scheint nichts deutlicher auf diese Leere des modernen Subjekts hinzuweisen als das reale Phänomen des Selfies, das direkt mit dem Smartphone assoziiert ist. „Sieh, mein liebes Ich, und siehe, liebes Nicht-Ich, ich bin noch da! Ich, dieses liebenswerte einmalige Individuum.“ Das Selfie ist nichts anderes als das fetischistische Festklammern am modernen Individualismus der Werbung, deren leeres Versprechen das Individuum dazu auffordert seine wirkliche Leere durch dieses narzisstische Verhalten zu übertünchen. Deswegen begegnen wir dem Selfie auch in den absurdesten Situationen: z.B. auf der eigenen Hochzeit, bei der Beerdigung der Großmutter, neben einer Unfallstelle, bei der Mahlzeit und natürlich auch später auf Toilette.[xii])
Präsent – Präsenz – Präsens
Das Stichwort Präsent (Geschenkt) führt uns nun tatsächlich zurück zum Thema Weihnacht. Wenn inzwischen ein Großteil der Hauptfeste des Christentums kommerzialisiert wurden, dann lässt sich wohl einsehen, dass Weihnachten den Höhepunkt dieser Kommerzialisierung des Feiertags bezeichnet. Es gilt also, sich davor zu hüten das ‚Fest der Liebe‘ auf reinen Güterverkehr zu reduzieren. Wie durch die obige Paraphrase des Korintherbriefes angedeutet, kann hier kein Geringerer als der Apostel Paulus selbst helfen, dieser Gefahr zu begegnen.
„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke“ (1 Kor 13,1). In Hinblick auf unsere Problematik könnte man die Rede des Apostels auch wie folgt paraphrasieren: „Wenn ich nichts als Waren verschenke, durch die ich meine Liebe zum Ausdruck bringe, dann fehlt meinem Geschenk immer noch die wirkliche Liebe, wodurch es eben nur das billige Plastikspielzeug, die langweiligen Socken usw. bleibt, das schon morgen wieder in der Ecke liegt.“ Paradoxerweise verweist nun ja aber gerade dieser unförmige, buntverpackte Kram, den wir uns schenken auf genau diesen gleichsam erbärmlichen wie erhabenen Versuch, dem Anderen unser Innerstes als Präsent zu offerieren. Aber die formlose Masse darf nicht als Ersatzleistung für die Liebe gelten, es bleibt schlicht und ergreifend die Leere. (Man denke hier nur an den englischen Spruch „You can’t polish a turd…“, den die britische Extreme-Metal-Band Cradle Of Filth auf einer ihrer DVDs noch ergänzt mit „…but you can roll it in glitter“.)
Die wirkliche Liebe hingegen vermag diese Leere zu verklären, ohne sie durch ein billiges numinoses „Mehr“ aufzufüllen. „Und wenn ich meine ganze Habe verschenke und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.“ (1 Kor 13,3) Gebe ich auch Alles, die Liebe zeigt an, dass es letztlich Nichts ist, dass auch das Ganze unvollständig bleibt.[xiii] In diesem Sinne, so Žižek, weist die Liebe der Unvollkommenheit einen höheren Stellenwert als der Vollkommenheit zu. In der Liebe wird sich nicht über die Leere des Präsents hinweggetäuscht, sondern sie (die Leere) wird als essentiell begriffen. Damit durchbricht die Logik der Liebe den erschöpfenden Teufelskreis des Warenfetischismus und der abgründigen Selbstliebe des modernen Individualismus.
Aber mehr noch, denn schließlich verweist das Präsent als formloser Monolith somit nicht auf einen wesentlichen Inhalt hinter dem Geschenkpapier, sondern auf die Präsenz (Gegenwärtigkeit) des Schenkenden. Und – wie wir am Beispiel der ägyptischen Statuen sahen – auch seine Präsenz ist letztlich leer. Und wieder sagt die Liebe, dass genau diese Unvollkommenheit das Erhabene ist. Das Schöne an Weihnachten ist nun, dass wir uns gegenseitig beschenken, somit jeder zum unvollkommenen Schenker wird. Und so ermöglicht gerade das Fest der Liebe dadurch, dass es alle Lieben im Hier und Jetzt der Gegenwart (Präsens) zusammenbringt, die Liebe wirklich zu feiern: Denn wir lieben stets das Unvollkommene, eben weil es unvollkommen und auch wir selbst unvollkommen sind und seien dürfen. Die wirkliche Liebe entfaltet sich nicht in einem fernen ‚Danach‘, in einem Paradies oder sonstigem, das ein „Mehr“ an Glück, Lust oder weiß Gott was verspricht. Die Liebe begreift diese einfache, flüchtige Gegenwart und macht aus ihr hier und jetzt die Wahrheit des unbedingten Miteinander. Und zu Weihnachten feiern wir ebendiese Liebe.
(Und eines darf man nicht vergessen, woran uns glücklicherweise die Weihnachtsgeschichte erinnert: Christus wurde nicht in einem Palast geboren, sondern zwischen Stroh und Mist.)
[i] Hier und im Folgenden Ernst Bloch, Geist der Utopie. Faksimile der Ausgabe von 1918, Gesamtausgabe 16, Frankfurt/M. 1977, 21.
[ii] Ebd., 28.
[iii] Vgl. Ernst Bloch, Geist der Utopie. Bearbeitete Neuauflage der zweiten Fassung von 1923, Gesamtausgabe 3, Frankfurt/M. 1977, 32.33.
[iv] Ebd., 33
[v] Man denke hier zum Beispiel an Slavoj Zizeks beliebtes Beispiel zur Veranschaulichung der Ideologie einer Nation anhand der Konstruktion ihrer Toiletten.
[vi] Vgl. Karl Marx, Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Bd. 1, Berlin 1970, 223.
[vii] Das soll nicht heißen, dass diese Werbung deshalb auch nur irgendetwas Gutes an sich habe. Schließlich wird hier ja kein Smartphone beworben, sondern ein Portal, dass von nichts geringerem lebt, als dem kapitalistischen Teufelskreis von Produktion und Konsumption.
[viii] Bei den von Hegel nicht näher benannten Statuen handelt es sich wahrscheinlich um die Memnonkolosse. Einen kurzen Abriss zum besagten Phänomen bietet selbstverständlich https://en.wikipedia.org/wiki/Colossi_of_Memnon. Vgl. hierzu und im Folgenden Slavoj Žižek, Die gnadenlose Liebe, übers. von N.G. Schneider, Frankfurt/M. 2001, 103-106.
[ix] G.W.F. Hegel, Werke 3, Phänomenologie des Geistes, 14. Aufl., Frankfurt/M. 2017, 509.
[x] Žižek, op. cit., 105.
[xi] Ebd.
[xii] Die Abgründigkeit dieses Verhaltens hat natürlich auch ein eigenes Internet-Meme, das seinen exkrementalen Charakter hervorragend portraitiert: Auf der linken Bildhälfte sehen wir Neil Armstrong im Raumanzug posierend mit dem Mond im Hintergrund, auf der rechten das offensichtliche Selfie einer hübschen, jungen Frau mit ein paar Toilettenkabinen im Hintergrund. Neben Armstrong lesen wir folgenden Text: „Went to the moon, took 5 pictures.” Neben der jungen Frau: „Went to the bathroom, took 37 pictures.“
[xiii] Der folgende Gedanke orientiert sich an Slavoj Žižek, Die Puppe und der Zwerg. Das Christentum zwischen Perversion und Subversion, übers. von N.G. Schneider, Frankfurt/M. 2003, 116-118.





